Ein Jugendlicher flieht von Eritrea nach Regensburg
Heimat
Ich wurde 1998 in einer kleinen Stadt in Eritrea geboren und bin dort aufgewachsen. Die Stadt liegt im Hochland südlich von der Hauptstadt Asmara. Dort leben etwa 3000 Menschen, die meisten von der Landwirtschaft. Ich wuchs dort in meiner Familie auf mit meinem älteren Bruder Meron und sieben jüngeren Geschwistern. Ich habe aber meistens bei meinen Großeltern gelebt, weil ich sie sehr gerne hatte.
Mein Vater war Soldat und kam nur einmal im Jahr nach Hause. Er blieb bei uns einen Monat, dann ging er wieder zum Militär. 1998 wurde er schwer krank, wurde aber trotz seiner Krankheit nicht vom Militär entlassen. Nach dem Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien wurde er im Jahre 2005 nach über 30 Jahren Militärdienst entlassen. Sie haben ihn freigelassen, weil er wegen seiner Krankheit nicht mehr für sie arbeiten konnte. Er bekam nur eine minimale Abfindung und danach keine Rente.
2009 sagte die Regierung von Eritrea, wenn die Menschen in die Region Gash-Barka umziehen, fänden sie dort ein besseres Leben, könnten erfolgreich Landwirtschaft betreiben und hätten bessere Chancen für die Kinder. Gash-Barka ist eine Region im Westen von Eritrea mit viel Wald. Da sind nicht so viele Menschen und es gibt nicht viel Wasser. Viele Menschen zogen dorthin, aber es gab nicht, was versprochen worden war. Meine Familie zog auch dorthin wie viele andere. Es war ganz anders und die Menschen sind in ihrem eigenen Heimatland fremd geworden. Das Klima ist sehr heiß und es gibt wenig Wasser und wenig zu essen. Es fehlt auch an Medikamenten und Ärzten. In dieser Gegend gibt es an dem Grenzfluss Setit viele Mücken, die Malaria übertragen, die sehr verbreitet ist. Die meisten Menschen wurden an die Grenze von Eritrea, dem Sudan und Äthiopien gebracht. Sie wurden von den ansässigen Menschen Flüchtlinge genannt.
Damals sind viele Menschen aus dieser Gegend in die Nachbarländer geflohen, weil der Weg von dort nicht weit ist. Dort blieben nur die Menschen, die nicht flüchten konnten, und Kinder. Es gibt dort viele Schlepper, die Menschen in den Sudan bringen und dafür viel Geld verlangen.
Ich kam erst 2010 von meinen Großeltern zu meiner Familie und es war alles anders für mich. Die Menschen und die Sprache, also alles war neu für mich. Dort wohnen unterschiedliche Ethnien mit verschiedenen Sprachen, wie Kunama, Saho, Nara, Bilen und Tigrinya, meiner Muttersprache, die dem Äthiopischen verwandt ist. Die meisten sprechen arabisch, aber sie verstehen auch Tigrinya. 2010 fing ich mit der Schule an und hatte Schwierigkeiten mit den Mitschülern, weil ich neu war und niemand hatte, den ich kannte. Wir hatten wenige Lehrer und verbrachten viel Zeit beim Spielen. Man ging einfach in die Schule und blieb zwei oder drei Stunden. Die meisten Schüler hatten wenig Interesse an der Schule und die Lehrer hatten auch keine Lust zu unterrichten. Da musste man selber einen Weg finden, wie man lernen konnte. Ich lernte die Naturwissenschaften auch privat und musste viel selbstverdientes Geld zahlen, weil ich weiterlernen wollte.
2010 musste ich die jährliche allgemeine High- School-Prüfung machen in den Fächern Englisch, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geographie, Geschichte und Sport. Ich bestand sie erfolgreich mit guten Noten. Dann musste ich mir eine Arbeit suchen, obwohl ich erst zwölf Jahre alt war. Ich arbeitete nach der Schule jeden Nachmittag und hatte keine freie Zeit mehr. Ich hatte damals einen Wagen, der von einem Esel gezogen wurde, und konnte mit kleinen Transporten etwas Geld verdienen. Ich hatte gute Freunde gefunden, mit denen ich in der Schule zusammen war. Wir trafen uns fast jeden Tag bei der Arbeit. Wenn einer von uns ein Problem hatte, lösten wir es gemeinsam, egal, ob es um Geld ging oder etwas Persönliches.
2012 flohen viele junge Menschen aus Eritrea, die meisten Schüler und Minderjährige. Wir blieben wenige Schüler in der Schule; es flüchteten sogar die Lehrer, weil sie sich in Eritrea nicht wohlfühlten. Viele flohen in den Sudan, von wo sie nach Israel weitergehen wollten. Aber sie mussten viel Geld an Schlepper zahlen. Wenn sie kein Geld hatten, dann wurden sie gefoltert, vergewaltigt, getötet! Ich hatte bei unseren Nachbarn einen Freund, der im Sinai in die Hände von Verbrechern fiel, die Lösegeld erpressen wollten. Seine Familie hatte kein Geld, weil sie arm war und sein Vater gestorben war. Seine Mutter wurde von den Verbrechern am Telefon unter Druck gesetzt und musste seine Schmerzensschreie anhören. Sie versuchte das Geld aufzubringen, aber soviel konnte sie nicht sammeln. Nach sieben Monaten sagten die Schlepper am Telefon, dass er tot sei.
2013 habe ich mit meinem Freund Yemane die Schule verlassen, weil wir unseren Familien helfen mussten. Da war ich 15 Jahre alt. Meine jüngeren Geschwister waren alle noch klein. Mein Bruder Meron war schon 2009 in den Sudan geflohen. 2013 waren nur noch wenige junge Menschen in der Stadt zu sehen. Jeden Monat kamen die Soldaten und holten Jungen und Mädchen ab, die nicht zur Schule gingen, und zwangen sie zum Militärdienst. Deswegen wollte niemand dort bleiben.
Über die Grenze
Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen und beschlossen, wie unsere Freunde und viele andere Eritreer, zu fliehen, Wir haben alles geplant, wann und wie wir aus Eritrea fliehen wollten. Ich und mein Freund Yemane entschieden uns, auch in den Sudan zu fliehen. Im September 2013 gingen wir um 18 Uhr aus unserem Haus und es wusste niemand, wohin wir gingen. Wir wollten es einfach versuchen. Wir sagten uns, wenn wir vom Militär entdeckt würden, wollten wir weglaufen. Wenn sie auf uns schießen, wollten wir lieber unser Leben riskieren als ihnen in die Hände zu fallen. Um 19 Uhr gingen wir aus der Stadt. Wir hatten fast nichts mitgenommen und auch keine Ahnung wie es an der Grenze aussieht. Es war hell bei Vollmond und man konnte alles sehen. Daran hatten wir nicht gedacht und es war für uns sehr gefährlich. Aber wir hatten Glück und wurden nicht entdeckt. Am Rande der Stadt fanden wir einige junge Hirten, die Schafe, Kühe und Kamele dabei hatten. Wir fragten sie nach dem Weg und sie halfen uns. Wir gingen weiter durch einen Wald. Es gab da keine Schlangen und andere gefährliche Tiere. Wir sahen nach eineinhalb Stunden ein Licht von einer Stadt des Sudan. Sie heißt Hamleit. Wir freuten uns sehr und liefen schneller. Aber wir fühlten uns noch nicht sicher, weil wir noch nahe an der Grenze waren. Wir hatten gehört, dass die Soldaten von Eritrea auch jenseits der Grenze im Sudan waren. Deswegen hatten wir Angst. Nach zwei Stunden kamen wir in die Nähe der Stadt zu Feldern. Aber wir wussten nicht, ob die Felder zu Eritrea oder dem Sudan gehörten. Es war ganz still. Wir hörten nur ein bisschen sudanesische Musik. Wir liefen schnell ohne Pause bis in die Stadt Hamleit und fanden am Stadtrand spielende Kinder. Die fragten wir, wo die Polizeistation sei. Dort wurden wir mit unseren Namen registriert. Neben der Polizeistation gab es ein Haus, in dem viele Menschen waren. Wir trafen dort viele unserer Freunde wieder, die auch geflohen waren. Wir fragten einander, wie die Flucht verlaufen war, und freuten uns sehr, wieder zusammen und in Sicherheit zu sein. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir uns so freuten und soviel zu erzählen hatten.
Im Sudan
Wir blieben zwei Tage in Hamleit. Nach einer Woche kam ein LKW und brachte uns in eine andere Stadt, wo wir viele Flüchtlinge sahen. Die Stadt heißt Schegereab. Dort waren hunderttausende Menschen aus Eritrea und jeden Tag kamen Tausende dazu. Alle mussten im Freien schlafen und es gab keine Decken oder was man sonst zum Schlafen braucht und nicht viel zu essen. Mit meinem Bruder und meinem Onkel hatte ich nur über mein Handy Kontakt. Ich blieb dort zwei Tage, dann sind alle meine Freunde weggegangen und nach Khartum gefahren. Ich war wütend, weil ich alleine geblieben bin. Ich wollte mit ihnen gehen, aber mein Bruder und mein Onkel wollten das nicht. Ich sollte mich mit einer Frau treffen, die mit den Schmugglern zusammenarbeitet. In der Nacht traf ich die Leute und hatte Angst, weil ich ganz allein war und nicht wusste, was sie mit mir machen würden, ich bin aber trotzdem mit ihnen gefahren.
Sie fuhren sie sehr schnell los, weil die Polizei uns folgte. Es gab eine Kontrolle und die Polizisten haben mich als Flüchtling erkannt. Der Fahrer hat den Polizisten Geld gegeben und sie haben uns durchgelassen. Wir kamen in eine andere Stadt, dort haben sie mir das Handy und das Geld, das ich hatte, weggenommen, so dass ich keinen Kontakt mehr mit meinem Bruder und den anderen aufnehmen konnte. Sie brachten mich zu einer sudanesischen Familie. Da musste ich draußen schlafen, bekam nichts zu essen und konnte nur Wasser trinken.
Nach zwei Tagen kam der für mich zuständige Schmuggler aus Eritrea. Er gab mir ein Handy und kaufte einen Fahrschein für mich und ich fuhr mit dem Bus nach Khartum. Mein Onkel hat das alles bezahlt. Ich hatte ein weißes Gewand an wie die Araber und niemand hat mich gefragt, ob ich Ausländer sei. Aber wenn sie mich gefragt hätten, hätte ich gar nichts antworten können, weil ich die arabische Sprache nicht kann. Wir fuhren acht Stunden bis Khartum.
Khartum
In Khartum wohnte ich bei Freunden und arbeitete ein bisschen auf dem Bau. Dann fing ich mit einem Bekannten eine Arbeit in einem Restaurant an. Ich arbeitete einige Monate dort als Kochhelfer. Das lief ganz gut, ich wollte aber weiter nach Europa kommen, weil ich dort nicht weiter illegal bleiben konnte. Damals war der Weg durch die Wüste sehr gefährlich. Ich hätte nur die Möglichkeit gehabt, mit dem Flugzeug zu fliegen, aber das ging nicht ohne Pass. Deswegen habe ich nach sechseinhalb Monaten Aufenthalt in Khartum selber entschieden, durch die Sahara nach Libyen zu gehen. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, dass ich nach Europa wolle. Er sagte, du bleibst dort, wo du bist. Sie hatten Angst vor dem IS und der Wüste und weil damals so viele Menschen im Mittelmeer ertrunken waren. Aber ich hatte keine Angst. Mehrere, die ich kannte, waren bereit durch die Wüste zu gehen. Da habe ich mir gesagt, ich gehe auch mit. Zu niemandem aus meiner Familie habe ich etwas davon gesagt.
Durch die Wüste
Am 2. April 2014 fuhren wir mit einem Bus von Khartum bis zu einem Dorf. Da waren hunderte Menschen unterwegs so wie wir. Um Mitternacht kam ein Lkw und sie luden alles ein, was wir dabei hatten. Wir waren mindestens 150 Menschen auf dem offenen LKW,. Wir fuhren sehr schnell über Sand- und Schotterpisten und hatten keinen Schutz vor der Sonne und dem Staub. Wir konnten uns nicht hinsetzen, mussten uns an Stangen festhalten und die ganze Nacht stehen, egal ob Männer, Frauen oder Kinder. Wir sind am ersten Tag bis zu 10 Stunden ohne Pause bis zur ägyptischen Grenze gefahren. Der Fahrer musste nachts schnell über die Grenze fahren, sonst wären wir erwischt worden. Jeder von uns ist krank geworden. Aber man konnte nichts machen. Wir konzentrierten uns nur darauf, dass es die nächste Pause gab.
In Ägypten
Am zweiten Tag fuhren wir circa sechs Stunden, machten Pause und fuhren am Abend weiter. Wir schliefen an einem Berg und wachten gegen sechs Uhr auf. Wir sind den ganzen Tag unterwegs gewesen und trafen am Abend auf fünf kleinere libysche Laster, Toyota- Pickups, die uns für die Fahrt nach Libyen abholen sollten. Wir wechselten von dem LKW in die Pickups. In einen sind am Anfang 30 Personen eingestiegen. Sie waren so klein, dass wir nichts zum Essen und Trinken einladen konnten. Wir konnten nur selber einsteigen und mussten alles, was wir dabei hatten, wegwerfen. Dann kamen noch 50 Jungen aus dem Sudan dazu, sodass wir insgesamt 200 Personen waren, 40 Personen auf jedem Wagen. Ich hatte einen ganz schlechten Platz. Ich musste auf der Bordwand sitzen mit den Beinen außerhalb über dem Rad. Ich saß auf einem Plastikkanister, der hin und her rutschte. Ich dachte, ich bleibe hier in der Wüste, weil ich fast heruntergefallen wäre. Aber andere Mitfahrer haben mich immer festgehalten und nach einiger Zeit einfach hochgehoben und über die Köpfe der anderen nach innen geworfen. Da war ein solches Gedränge, dass ich meine Schuhe verloren habe. Die Fahrer fuhren so schnell über die wellige Sandpiste, dass wir dauernd hin und her geschleudert wurden und uns aneinander festhalten mussten.
Nach kurzer Zeit sind ägyptische Soldaten gekommen. Es war schon ziemlich dunkel und sie konnten uns aus der Ferne nicht sehen. Da ließen uns die Fahrer schnell aussteigen und wir mussten uns alle flach auf den Boden legen. Die Fahrer sind einfach weitergefahren. Die Soldaten haben uns nicht liegen gesehen, sie haben aber die Autos verfolgt und eines festgehalten. Die anderen vier kamen zurück und mussten nun noch mehr Leute aufnehmen. Es kam auch vor, dass wir lange durch den heißen Sand zu Fuß gehen mussten, weil die Autos es nicht schafften, über die Sandberge zu kommen. Die meisten von uns hatten keine Schuhe an. Es war sehr heiß und wir hatten wenig Wasser. Wir mussten Wasser trinken, das mit Benzin verunreinigt war. Aber man musste es trotzdem trinken, um zu überleben. Sonst konnte es sein, dass man so erschöpft war, dass man sich nicht mehr bewegen konnte. Die Autofahrer gingen auch nicht gut mit uns um, sie haben uns beschimpft und geschlagen. Wir waren für die Libyer wie Hunde, die auf sie hören müssen. Wenn wir nicht taten, was sie sagten, drohten sie uns, dass sie uns einfach in der Wüste zurücklassen oder sogar töten würden. Nach fünf Tagen kam ein LKW und nahm vierzig Leute mit. Wir hatten nun mehr Platz in den Autos, konnten schlafen und aufrecht stehen.
Es war gut, mit dem Lastwagen zu fahren, aber nach einem Tag blieb er in einem Salzsumpf stecken und kam nicht mehr heraus. Wir haben die ganze Nacht versucht, den LKW auszugraben und herauszuschieben, aber es ging nicht und er kam nicht mehr heraus. Es gab nur Salz und Salzlake und wir hatten nichts zu essen und zu trinken und waren sehr erschöpft. Aber trotzdem arbeiteten wir weiter. Nach eineinhalb Tagen kam ein großer LKW, um den anderen herauszuziehen. Er landete aber im feinen Sand und blieb auch stecken. Da hatten wir ein großes Problem und dachten, wir könnten Libyen nicht mehr erreichen. Es war ganz schlimm. Ich war der Kleinste von allen. Die anderen waren kräftige Burschen. Wir bekamen ein bisschen zu essen und zu trinken, gaben uns noch mehr Mühe und haben den anderen LKW rausgeholt. Wir freuten uns mächtig und erreichten nach fünf Stunden Islavia, eine Stadt in Libyen.
In Libyen
Am 16. April 2014 kamen wir in diese Stadt. Wir durften auf dem LKW nicht aufstehen, damit uns niemand sah, und wurden zu einem Haus gebracht, das voller Menschen war. Hier trafen wir unsere Freunde wieder. Es gab aber keinen Platz, wo wir schlafen konnten, und es gab nichts zu essen. Wir waren sehr müde und mussten draußen schlafen ohne Zudecken oder warme Sachen, obwohl es in der Nacht kalt war. Wir freuten uns nur, dass wir es bis Libyen geschafft hatten. Am nächsten Tag sagten uns die Libyer, wir sollten sofort unsere Familien anrufen und so schnell wie möglich das Geld für die Fahrt bezahlen – 1.600 Dollar. Man kann von überall her mit dem Handy das Geld überweisen – von Afrika, Europa oder Amerika. Sie hatten Verbindungsleute, die das Geld von den Familien bekamen. Ich versuchte den ganzen Tag, meine Familie oder meinen Onkel zu erreichen, kam aber nur an die Mailbox. Meine Familie wusste nicht, dass ich in Libyen war. Sie wussten nur von meinem Aufenthalt im Sudan. Wenn man nicht bezahlen konnte, kam man in eine Art Gefängnis und wurde nicht herausgelassen, egal ob man vielleicht krank war oder auch nur aufs Klo musste. Ich musste da auch hinein. Ich durfte nicht telefonieren, bekam wenig zu essen und wurde oft mit Plastikpeitschen geschlagen. Da drin war ich nur einen Tag. Dann hat mein Onkel erfahren, dass ich dort bin, rief mich sofort an und bezahlte das Geld. So kam ich aus dem üblen Haus und es ging alles gut weiter. Die Menschen, die für uns zuständig waren, verkauften ein Brot für fünf Dollar oder mehr. Wer kein Geld hatte, musste hungrig bleiben.
Nach zehn Tagen kam ein Lastwagen mit einem Container und alle, die bezahlt hatten, sind an die Reihe gekommen und wurden gezählt. Wir waren etwa 135 Menschen. Bevor wir in den Container stiegen, haben sie uns untersucht, ob wir Handy und Geld dabei haben, und haben uns alles weggenommen. Das interessierte uns aber nicht mehr. Wir wollten nur Tripolis erreichen und so schnell wie möglich nach Italien. Wir haben uns keine Gedanken gemacht, was auf dem Weg noch alles passieren könnte. In Libyen war gerade Bürgerkrieg und Stammes-Milizen bekämpften sich zum Teil mit schweren Waffen. Wir haben auch Panzer gesehen. Wir waren alle nur froh, dass wir nach Tripolis fuhren. Der Container war so präpariert, dass er hinten eine normale Ladung Kartons voll mit Keksen hatte und dahinter zwei Räume mit einer Zwischendecke. Es gab keine Tür. Wir sind einfach von unten eingestiegen. Die Öffnung war gar nicht zu sehen. Wir fuhren die ganze Nacht. Der Wagen wurde mehr als fünfmal untersucht, aber wir wurden nicht gefunden. Es war nur ein Glück, dass wir es schafften. Um sechs Uhr morgens waren wir in Tripolis. Wir blieben dort zwei Tage und mussten wieder unsere Familien anrufen, dass sie schnell für uns Geld zahlen. Wir mussten 2.000 Dollar von Libyen nach Italien überweisen. Nach vier Tagen bezahlte meine Familie und mein Onkel über ihr Handy das Geld und dazu für mich 200 Dollar, die ich unbedingt in Italien brauchte. Aber die 200 Dollar bekam ich nicht.
Übers Meer
Eines Nachts sagten sie, alle, die bezahlt hatten, sollten sich fertigmachen zur Abreise und rausgehen. Wir waren 350 Personen und wir verteilten uns auf Autos und Busse, die uns zum Meeresstrand brachten, wo Boote lagen. In der Nacht konnten wir in ein Boot einsteigen. Das Boot war aus Holz und sehr klein. Es hatte ein erstes und ein zweites Deck. Der Motor war sehr schlecht, aber wir fuhren um ein Uhr nachts, es war der 30. April, in aller Stille los. Da bin ich zum ersten Mal mit einem Boot auf dem Meer gefahren. Unterwegs ist ein Teil des Oberdecks abgebrochen. Nach sechs Stunden Fahrt blieb der Motor stehen. Der tunesische Kapitän schaffte es aber, den Motor zu reparieren und wieder in Gang zu bringen. Nach 12 Stunden Fahrt sahen wir ein großes italienisches Schiff der Marine und wir gaben ein Signal, um auf uns aufmerksam zu machen. Sie kamen sofort auf uns zu, unser Motor wurde gestoppt. Unser Kapitän setzte sich zu uns Flüchtlingen, damit er nicht erkannt und verhaftet wurde. Die Italiener fragten als erstes, wer der Kapitän sei, aber niemand verriet ihn. Soweit ist alles gut gegangen. Einige von uns konnten italienisch sprechen. Sie übersetzten uns, dass wir zu ihnen umsteigen sollten und es müssten Fingerabdrücke gemacht werden. Wir waren informiert worden, dass wir dann in Italien bleiben müssten. Das wollten wir aber nicht und sagten mit viel Geschrei, wir würden lieber in unserem Boot bleiben. Die Italiener verzichteten dann darauf und sagten, wir wollen euch nur retten. Wir sind daraufhin alle in das italienische Schiff übergestiegen und fuhren acht Stunden bis Italien. Am zweiten April sind wir in Sizilien angekommen.
In Italien
In Sizilien wurden wir von einer großen Menschenmenge erwartet, viele machten Fotos von uns. Wir wurden dann mit einem Bus zu einer Basketballhalle gebracht. Da waren viele Polizisten. Die forderten uns auf, auszusteigen. Wir stiegen aber nicht aus, weil wir fürchteten, dass wir, wenn wir in die Halle hineingingen, nicht mehr herauskommen würden, bevor sie uns registriert und unsere Fingerabdrücke genommen hätten. Wir wollten das nicht, weil keiner von uns in Italien bleiben wollte. Sie brachten Essen und Trinken und sagten, kommt raus aus dem Bus und ihr könnt Essen und Trinken bekommen. Obwohl wir seit drei Tagen nichts mehr bekommen hatten, ist niemand von uns ausgestiegen. Sie warteten drei Stunden, aber wir blieben im Bus.
Schließlich sagten sie, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt, und öffneten die Tür. Wir liefen alle in die Stadt Agrigent. Als es dunkel wurde, kamen einige eritreische Schmuggler mit einem Auto und sagten, dass wir 50€ zahlen müssen und wurden zu einem Camp gebracht. Da rief meine Familie bei den Schmugglern an und sagte mir, sie freuten sich, dass ich es bis Europa geschafft hatte. Nach einer Woche kam ich nach Rom. Ich brauchte dringend Geld, um einzukaufen und nach Deutschland weiterzureisen. Von meiner Familie und meinem Onkel bekam ich 1.200 € und konnte alles kaufen, was ich brauchte. In Rom blieb ich zehn Tage. Ich schlief im Keller eines Hochhauses, das Eritreern gehörte und wo Tausende Menschen wie ich waren. Da gab es kein Problem. Dann fuhr ich zu einem Bekannten, auch ein Eritreer, nach Mailand und konnte bei ihm zwei Wochen bleiben. Dann wollte ich weiter nach Deutschland und bekam von anderen eine Bus-Fahrkarte, für die ich 550 € zahlen musste. Ich wusste nicht, wieviel die Fahrkarte wirklich kostete. Erst als ich in München ankam, sah ich, dass sie nur 80 € gekostet hatte.
In Deutschland
Ich wollte mit dem Bus eigentlich zu meiner Tante nach Frankfurt fahren. An der deutschen Grenze wurden ich und mehrere Jungen aus Somalia und Syrien von der Polizei kontrolliert. Wir hatten keine Ausweispapiere dabei. Daher wurden wir nach München gebracht, dort kam ich am 1. Juni 2014 an. Ich war also fast neun Monate unterwegs gewesen. Wir wurden untersucht und die Fingerabdrücke genommen. Wir wurden gefragt, woher wir kommen, wohin wir wollen, wie alt wir sind und nach unseren Eltern. Danach kamen wir nach Rosenheim. Dort habe ich einen Jungen meines Alters kennengelernt, er heißt Gere, und wir kamen zusammen nach Regensburg. Wir wohnten drei Monate im Kinderheim St. Vincent und gingen in eine Lehrwerkstatt und in die Schule. Danach wechselten wir zum Heim für „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ und sind in die Berufsschule BS II gegangen. Daneben machten wir verschiedene handwerkliche Praktika. In der Gruppe der Jugendlichen hatten wir Betreuer, die alle nett zu uns und hilfsbereit waren.
Dann kam ich in die Ostengasse in eine WG mit zwei Jungen aus Eritrea und Somalia. Wir wohnen nun schon lange zusammen und verstehen uns gut. Wir haben auch einen wunderbaren Betreuer vom Jugendamt, der uns hilft und zu uns wie ein Freund ist. Er ist auch Musiklehrer und wir können bei ihm Trommeln und Gitarre lernen. Manchmal haben wir auch Auftritte mit unserer Trommelgruppe. In unserer WG treffen wir uns oft mit anderen Jungen aus Eritrea, kochen gemeinsam und unternehmen etwas. Wir feiern zusammen mit anderen Gästen Geburtstage und andere Feste. Zu Ostern 2016 waren wir in Nürnberg in der Eritreisch-Orthodoxen Kirche. Ich habe auch deutsche Jugendliche kennengelernt. Wir haben auch Patenfamilien, die uns helfen und etwas mit uns unternehmen, zum Beispiel Ausflüge in die Umgebung von Regensburg. Meine Paten treffe ich jede Woche und wir unterhalten uns über alles, was ich wissen will, und wir machen Übungen, um meine Aussprache zu verbessern. Auch bei diesem Text haben sie mich unterstützt.
Im Herbst 2015 habe ich für den Regensburger Jugendbeirat kandidiert und in den Schulen und anderen Bereichen, wo Jugendliche anzutreffen sind Wahlkampf gemacht. Zwar bin ich nicht gewählt worden, aber ich freute mich, mitgemacht und viele Jugendliche kennengelernt zu haben. Im Jahr 2016 war ich im zweiten Schuljahr an der Berufsschule. In der Schule war ich drei Tage in der Woche. Zwei Tage machte ich ein Praktikum oder war beim Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft (bfz). Das Schuljahr ging bis Juli. Nun habe ich den Hauptschulabschluss bekommen und es kann mit der Ausbildung weitergehen. Ich habe mich bei der Arbeitsagentur für eine Ausbildung als Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen beworben. Im Einstellungstest habe ich in Deutsch den Grad B 2 erreicht, einen Fortgeschrittenengrad in den Stufen A, B und C. Das war für mich eigentlich nicht schwierig und ich habe schon den Bescheid bekommen, dass ich im September mit der Ausbildung anfangen kann. Im März 2016 wurde ich als Flüchtling anerkannt und bekam meine Aufenthaltserlaubnis. Im Mai hatte ich meinen achtzehnten Geburtstag. Ich bin nun volljährig und brauche keinen Vormund mehr. Auch bekomme ich bald einen Reisepass.
Am 5. April 2016 habe ich auf einer Schul-Veranstaltung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ mein Gedicht über die Flucht vorgelesen. Das ging gut und kam bei den Mitschülern gut an. Vorher dachte ich, ich würde sehr aufgeregt sein, aber ich war im Gegenteil ganz ruhig. Bei der großen Feier zum Schuljahresende konnte ich es nochmals vortragen.
Flucht und Menschheit unserer Welt
Es ist die Zeit, in der man sich von der
geliebten Familie trennt.
Es ist die Zeit, in der man nach der Freiheit sucht.
Es ist die Zeit, in der man seine Heimat verlässt.
Jedes Jahr fliehen Menschen vor dem Krieg.
Jeden Monat fliehen Menschen vor der Verfolgung.
Jede Woche fliehen Menschen vor der Vergewaltigung.
Hunderttausende Jugendliche fliehen vor der drohenden Todesstrafe.
Kinder und Jugendlichen fliehen vor den Diktatoren.
Sie fliehen alle vor den schweren Menschenrechtsverletzungen.
Kinder sind auf der Flucht, anstatt zur Schule zu gehen.
Jugendliche sind auf der Flucht, anstatt ihr Land aufzubauen.
Sie sind ohne Familie, von ihren Eltern getrennt.
Sie wurden in das Land der Freiheit geschickt.
Sie wussten nicht, was vor ihnen liegt.
Sie laufen einfach fort und dahin, wo es Freiheit gibt.
Wer kann sagen, wie es weitergeht?
Wer kann sagen, was mit uns morgen passiert?
Ist das Problem die Welt?
Ist das Problem die Zeit oder?
Ist das alles die Schuld der Menschheit?
Ja, nun weiß ich, dass an den Problemen dieser Welt die Menschheit schuld ist!
Aber was sollen die unschuldigen Menschen tun, damit sie überleben?
Was können sie tun, wenn ihre Häuser zerstört,
Wenn ihre Tiere verhungert,
Wenn ihre Städte verwüstet sind,
Wenn die Kinder hungern und ohne Zukunft sind.
Was sollen sie tun?
Denn wir haben doch nur eine Welt, die uns trägt.
Man denkt nur noch negativ.
Man denkt nur an sich und sagt: Nur für mich.
Manche hassen die Anderen, wegen ihrer Hautfarbe.
Manche werden gehasst, wegen ihrer Religion.
Wir sind doch alle Menschen.
Es wäre doch egal, an wenn man glaubt,
Woher man stammt und wie man ausschaut.
Niemand weiß, welches Problem die Welt hat.
Jeder will sie nur zerstören.
Die Menschen zerstören alles nach und nach.
Geld wurde wertvoller als die Menschen.
Das ist die Zeit, in der Gold wertvoller ist als der Mensch.
Wir sind doch alle Menschen.
Egal ob Moslem oder Christ.
Egal ob Schwarz oder Weiß.
Egal ob reich oder arm.
Bitte helfen wir denen, die Probleme haben.
Weil wir Menschen nicht wissen, was mit uns in einer Sekunde passieren wird.
Dann werden wir ernten, was wir säen.
Menschen fliehen nicht, weil sie ihre Heimat hassen.
Menschen fliehen nur, weil sie in ihrem zerstörten Land keine Zukunft haben.
Sie fliehen alle aus Zwang.
Sie laufen einfach nach vorne, egal ob es kalt oder warm ist.
Unter Lebensgefahr erreichen sie ein demokratisches Land.
Und wir alle bedanken uns bei denen, die uns geholfen haben.
Ihr habt uns bei euch eine Wohnung gegeben. Ihr habt uns aufgenommen.
Nehmt auch die Anderen auf, die noch auf der Flucht sind.
Lasst sie nicht frieren und hungern.
Da sind die Frauen und Kinder.
Da sind die Kinder, die geschützt werden müssen.
Und nun kämpfen wir alle gemeinsam für unsere Welt!
Kämpfen wir alle für die Zukunft der Kinder!
Kämpfen wir alle für unsere Jugendlichen,
Weil die Kinder und Jugendlichen unsere Zukunft sind,
Weil unsere Zukunft in ihren Händen liegt!
von Amanuel Yemane
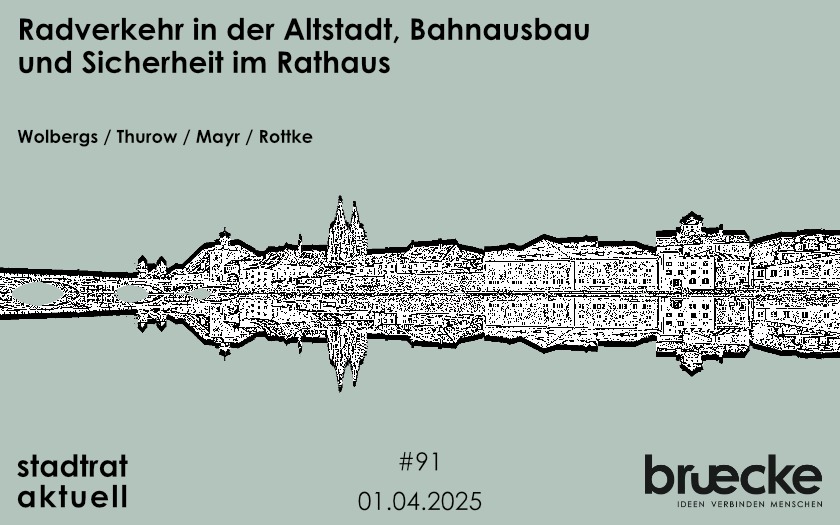
Radverkehr in der Altstadt, Bahnausbau und Sicherheit im Rathaus
Im Podcast stehen aktuelle Themen im Fokus: Die CSU will den Radverkehr in der Altstadt beschränken, während der Bahnausbau im Stadtwesten Fragen der Transparenz aufwirft, […]
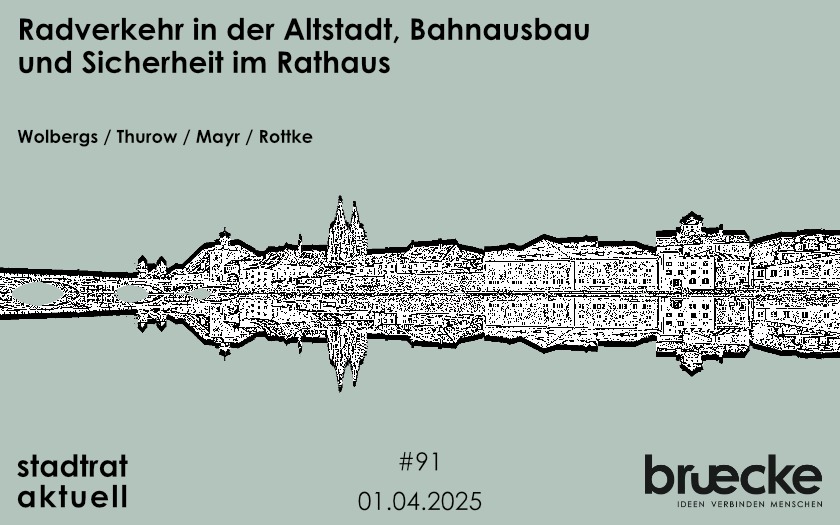
Radverkehr in der Altstadt, Bahnausbau und Sicherheit im Rathaus
Im Podcast stehen aktuelle Themen im Fokus: Die CSU will den Radverkehr in der Altstadt beschränken, während der Bahnausbau im Stadtwesten Fragen der Transparenz aufwirft, […]
Der Text wurde erstmalig veröffentlicht im Regensburger Almanach 2016, MZ Buchverlag, Regenstauf. Die dortige Redaktion hat den Text auch sprachlich minimal angepasst, allerdings nichts am Inhalt geändert
Danke an Amanuel für die Textfreigabe für „Brücke-online“.


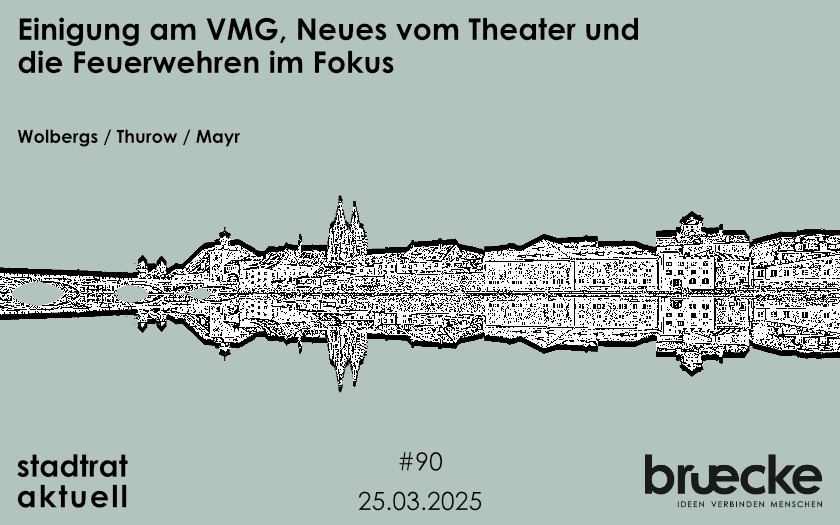
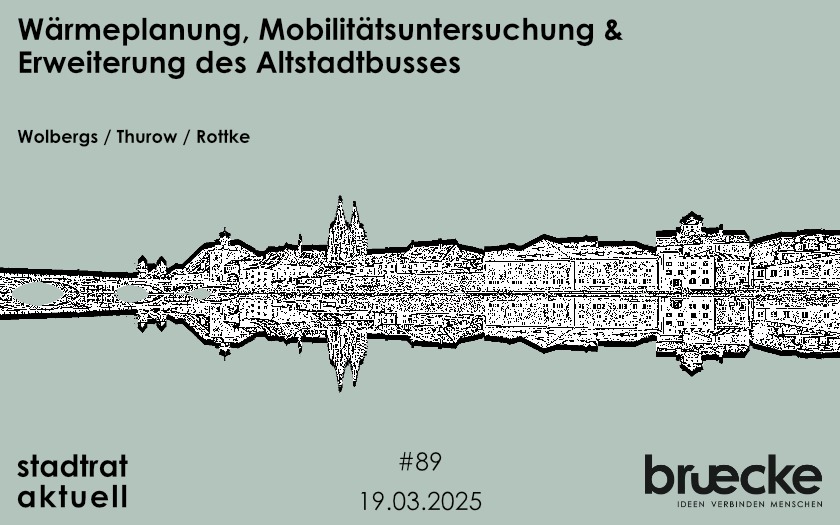
Gänsehaut. Tränen in den Augen. Danke Aman, dass du uns von der schwierigsten Geschichte deines Lebens erzählt hast.
Ich freue mich von ganzem Herzen, meine Geschichte mit Ihnen teilen zu dürfen. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Verein ,, BRÜCKE – Ideen verbinden Menschen e.V. – Regensburg„ und Enno Schulz, der dies ermöglicht hat. Vor allem aber freue ich mich, Teil dieses wundervollen Vereines und der sehr engagierten Menschen zu sein, die unsere Stadt zu einem besseren und angenehmen Ort für alle machen.
Danke Amanuel, dass Du Dein Erlebtes beschreibst. Es berührt mich sehr. Und Du gibst all jenen eine Stimme, die auch die Flucht erlebt haben. Ich danke Dir auch insofern, weil es mich an die Flucht erinnert, die meine Mama als Kind erlebt hat. Auch der Vater meines Mannes ist geflüchtet. Das ist lange vorbei und doch ist es die Geschichte von vielen von unseren Eltern. Das wird leider zu oft. vergessen. Mein Dank ist also ein mehrfacher. Bea Szabo